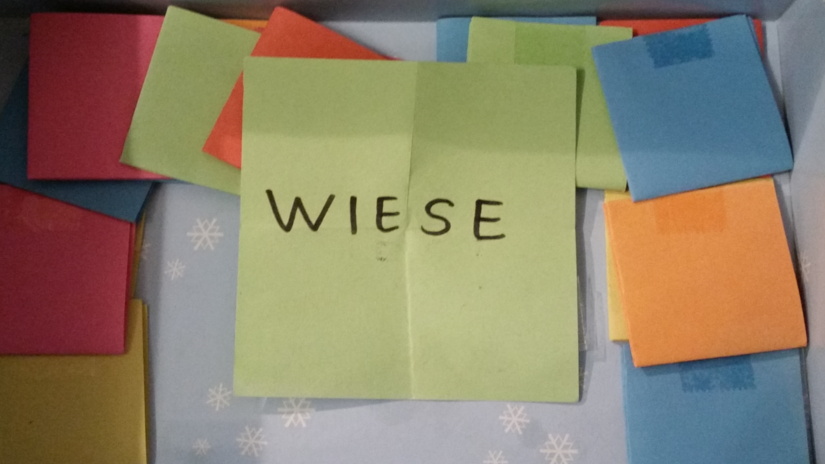
Vor diesen drei Dingen habe ich in meinem Leben am meisten Angst:
1) Vor der sogenannten Hundewiese in Bad Vilbel.
Geht man hier mit dem eigenen Hund spazieren, trifft man viele andere Hundebesitzer, die es einem gleichtun. Das Aufeinandertreffen mit Hundebesitzern empfinde ich stets als unangenehm, da ich mit Menschen in Kontakt komme, mit denen ich zunächst lediglich eine einzige Gemeinsamkeit teile: Den Hund. Andere Gemeinsamkeiten werden nicht weiter ergründet, stellt der Hund doch den offensichtlichsten gemeinsamen Nenner und somit auch den perfekten Gesprächseinstieg dar.
Und so redet man über nichts anderes als das Haustier. Wie alt ist es? Wo kommt es her? Wie lange haben Sie es schon? Guckt Ihr Hund auch immer so wie ein Hund der guckt wie ein Hund wenn er guckt wie ein Hund?
Mit der Zeit legt man sich für diese Momente lustige Floskeln zurecht: Freut sich ein Hund, dass er gestreichelt wird: »Der wird zu Hause bestimmt nie gestreichelt.« Kommt ein Hund auf einen zu und bettelt um Futter: »Der wird zu Hause bestimmt nie gefüttert.« Aussagen dieser Art werden stets mit einem breiten Grinsen und einem flachen Lachen kommentiert und lockern die Runde ein wenig auf. Außerdem muss man immer lachend schnaufen, wenn der eigene Hund mit einem anderen zu spielen beginnt. Die beschnuppern sich? Lachen. Die spielen? Lachen. Die gehen nebeneinander her? Lachen. Weil es so schön ist, dass sich die beiden vertragen und nicht gegenseitig zerfleischen.
Als Mensch mit Sozialphobie sind mir diese Treffen zuwider. Ich kann sie nicht leiden und nichts mit ihnen anfangen. Von außen betrachtet scheint mir all das nichts auszumachen, da ich schließlich genau wie alle anderen auch mit Floskeln um mich werfe, von meinem Hund erzähle, Pflegetipps anderer Herr- und Frauchen erdulde und fleißig von den eigenen Tierarzterfahrungen berichte. Nach den Treffen fühle ich mich jedoch dreckig und komme mir blöd vor. Nein, ich bin nicht auf niveuvolle Konversation aus. Ich will lediglich mit meinem Hund draußen umhertollen, ihm Bewegung bieten, ihn die Gegend erforschen lassen und dass er Spaß und Freude hat. Mein Hund freut sich sehr, wenn ich mit ihm rausgehe. Das soll er genießen. Er freut sich auch, andere Hunde zu treffen. Selbstverständlich werde ich ihm das nicht nehmen. Doch würde ich währenddessen gerne eine kleine Mauer um mich errichten, die anderen zeigt, dass ich mich nicht mit ihnen unterhalten möchte. Vielleicht würde ich noch ein paar Graffittikünstler anheuern, um die Mauer mit gigantischen Mittelfingern zu versehen. Einfach, um jedem klarzumachen, was ich mit meinem Gebilde sagen möchte.
Aber das geht nicht. Rennt mein Hund auf einen anderen zu, lege ich meinen Hundegeredehebel um und lasse die Show beginnen. Mittlerweile kenne ich viele Hundebesitzer, habe mich schon häufig mit ihnen unterhalten, kenne jedoch nicht einmal ihre Namen. Weil ich nicht frage, mich nicht vorstelle und sie es mir gleichtun. Manchmal denke ich mir: »Stell dich doch einmal vor.« Dann denke ich mir wiederum: »Nö.« und lasse es bleiben. Ich weiß nicht, ob es den anderen auch so geht. Sie stellen sich schließlich auch nicht vor. Ich könnte Sie ja mal fragen. »Sagen Sie, hassen Sie diesen aufgezwungenen Kontakt mit Menschen genauso wie ich?« Welche Antwort wäre wohl schlimmer? Das »Ja.« oder das »Nein.«?
Darum habe ich Angst vor der Hundewiese. Ich könnte schließlich mal auf einen Hundebesitzer treffen, der plötzlich private Fragen stellt. Mir seinen Namen nennt. Und am Ende auch noch mein Freund werden will. Ich will das nicht. Ja, ich habe einen Hund. Aber das heißt nicht, dass ich in einen Club aufgenommen werden will. Oder mich mit allen Hundebesitzern anfreunden oder zumindest gutstellen muss. Das Ganze erinnert mich an Treffen unter Eltern. Andauernd wird über die eigenen Kinder gesprochen, weil auch diese den offensichtlichsten gemeinsamen Nenner darstellen und man ansonsten nicht wüsste, worüber man sich mit diesen Fremden unterhalten sollte, als über die Ausscheidungen des frisch gezüchteten Kleinkindes. Mein Hund ist ein Lebewesen und mein Haustier, kein Gesprächseinstieg. Trotzdem kann ich Letzteres nicht vermeiden. Da ist es gut, dass ich meinen Hund so mag und diese sozialen und unangenehm menschlichen Probleme gerne für ihn in Kauf nehme.
Ich habe Angst vor menschlichen Kontakten. Und auf der Hundewiese kommt vieles zusammen, was ich nicht ausstehen kann.
2) Die Werwölfe von Düsterwald.
Es gibt kein Kartenspiel auf dieser Welt, das ich mehr verabscheue als dieses ekelhafte Fass voller Lebenshass. Meine Abscheu richtet sich aber nicht nur auf »Werwölfe«, sondern auch auf jeden anderen Ableger, der auch nur im Entferntesten mit ihm etwas zu tun hat. Einer ist der Böse und muss die anderen davon überzeugen, es nicht zu sein. Man lügt und lügt und lügt während die anderen versuchen, den Lügner zu enttarnen. Wird vorgeschlagen, eine Runde »Werwölfe« zu spielen, bin ich raus. Ich gucke gerne zu. Mitspielen kommt für mich nicht in Frage.
»Nicht mehr«, sollte ich wohl besser sagen. Ich habe es versucht, doch keine Runde »Werwölfe« hat mir bisher Spaß gemacht. Es dauert nur wenige Minuten und das Spiel wird mir unangenehm. Alle reden durch- und miteinander und versuchen, einen Schuldigen zu finden. Wird man zu Unrecht beschuldigt, muss man sich um Kopf und Kragen reden und egal, was man sagt, irgendein selbsternannter Sherlock-Holmes-Verschnitt dreht einem auf jeden Fall die Worte im Mund um. Schnell kristallisiert sich heraus, wer in der Runde am meisten von sich hält und die Gruppe zum Verräter führen möchte. Sagt man nichts, ist man der Verräter, weil man nichts sagt, ist man laut, ist man zu laut und somit der Verräter. Nein, ich habe nicht immer verloren. Ich kann sowohl die Rolle des Verräters als auch des Nichtverräters übernehmen. Aber es macht einfach keinen Spaß, einer Gruppe anzugehören, die »Werwölfe« spielt.
Einmal hat man mein Verhalten als Verräter kritisiert, weil ich in der ersten Runde die Person eliminiert habe, die in der Gruppe am häufigsten den Werwolf findet. Ich hätte damit die ganze Runde versaut, weil ich den rausgeschmissen habe, der für den meisten Spaß sorgt, weil er immer so clevere Überlegungen anstellt. Dies sei ein Anfängerfehler gewesen, den ich noch heute nicht nachvollziehen kann. Dass man ein komplettes Spiel mit der Eleminierung einer einzigen Person versauen kann, sagt nichts über meine spielerischen Leistungen aus, sondern eher über das Spiel, das gerade gespielt wird.
Aber ich kann so einiges nicht nachvollziehen. Wird der Verräter letztendlich nicht enttarnt und gibt er sich am Ende zu erkennen, geht sofort das »Ich habe es ja gewusst!«-Geschrei los. Natürlich nicht immer. Hin und wieder wird auch mal gelobt. Was mir aber egal ist. Ich freue mich, egal wie die Runde endet. Weil sie endet. Doch dann kommt schnell das »Noch eine Runde?« und ich muss mich beherrschen, nicht alles zu zerreißen, was irgendwie mit diesem Spiel in Verbindung steht.
Ich habe Angst davor, mit einer mir unbekannten Gruppe einen Spieleabend abzuhalten, weil es jederzeit passieren kann, dass jemand »Werwölfe« oder ein vergleichbares Spiel vorschlägt. Ab diesem Zeitpunkt fühle ich mich nicht mehr wohl.
3) Dass ich mich eines Tages umbringe.
Ich bin ein Versager. Ein gigantischer Versager. Ich habe in meinem Leben nicht viel auf die Beine stellen können, auf das es sich lohnt, stolz zu sein. Ich kann nichts. Ich bin nichts. Niemand interessiert sich für mich oder die Dinge, die ich mache. Ich mag meine Bücher noch so gut finden, niemand interessiert sich für sie. Ich bekomme so gut wie nie eine Rückmeldung, wenn jemand eines von ihnen gelesen hat. Was, wenn man nach Verkaufszahlen geht, nicht viele gewesen sein können.
Es tut weh zu sehen, wie eine Person mein Buch kauft, mir davon erzählt, sich anschließend aber nicht mehr bei mir meldet, um mir mitzuteilen, wie es ihr gefallen hat. Weil diese Person das Buch vermutlich gar nicht beendet hat. Weil es scheiße ist. Sie gelangweilt hat. Oder vielleicht hat sie es ja doch bis zum Ende gelesen, weil sie nett sein wollte. Darum meldet sie sich jetzt auch nicht mehr. Weil sie mir nicht sagen will, wie scheiße meine Bücher sind.
Leute teilen mir mit, ich könne gut schreiben, kaufen meine Bücher aber nicht, weil sie ihnen das Geld nicht wert sind. Weil meine Texte nur im kleinen Rahmen für die kurze Bespaßung nebenbei ausreichen, mehr aber dann auch wieder nicht können. Weil ich eigentlich gar nicht so gut schreiben kann, wie sie mir immer wieder sagen, um nett zu sein. Ich bilde mir nur ein, gut schreiben zu können. Ich würde es gerne können. Aber ich kann es nicht. Was ich nicht einsehen will. Ich will gerne gut schreiben können. Aber ich kann es nicht. Und das will ich nicht wahrhaben. Weshalb ich diesem Irrsinn auch heute noch hinterherrenne und alles in ihn reinstecke, was mir an Energie geblieben ist.
Was gar nicht stimmt. Für jemanden, der schreiben will, schreibe ich zu wenig. Meine Kurztexte sind rar geworden, mit meinen Büchern komme ich gerade nicht vorwärts. Ich schiebe das gerne aufs Studium. Auf die anstehende Bachelorarbeit. Aber das ist lediglich eine angenehme Ausrede, um den Tag über dann gar nichts zu machen und sich am Ende angenehm schlecht zu fühlen. Weil ich so ein verdammter Versager bin und einfach nichts auf die Reihe bekomme.
Was bleibt mir noch, wenn ich mit dem Schreiben aufhöre? Nichts. Das Schreiben ist mein einziges Standbein, das leider immer mehr an Kraft verliert. Als Versager fällt es mir schwer, mich aufzurichten und mir zu sagen: »Du schaffst das.« Weil das aller Wahrscheinlichkeit nach nicht stimmt. Weil es hoffnungslos ist. Niemand interessiert sich für mich. Niemand interessiert sich für meine Bücher. All die Menschen, die meine Werbebeiträge bei Twitter oder Facebook teilen, selbst meine Bücher aber nicht kaufen, machen es nicht besser. Sie machen es schlechter. Zum Teilen reicht es. Zum Kaufen nicht. Lass dem Typen mal seine Träume. Mein Geld bekommt der jedenfalls nicht. Dafür aber einen Like. Oder einen Daumen hoch. Lustig ist er ja, der Pausenclown. Würde ich ihn in der Stadt mit einem leeren Kaffeebecher in der Hand sehen, würde ich ihm vielleicht einen Euro zuwerfen.
Es wäre so unglaublich einfach, das alles zu beenden. Einen Zustand zu erreichen, in dem mich all die Sorgen nicht mehr plagen. In dem ich mich nicht mehr darum kümmern muss, dass Menschen meine Bücher kaufen oder mich bei Patreon unterstützen oder überhaupt beachten. Es wäre so unglaublich einfach. Zumindest gibt es diese Momente, in denen mein Gehirn mir das mitteilt und ich plötzlich mit Hilfe meines Gehirns gegen mein Gehirn anreden muss. Bisher hat das auch immer gut funktioniert. Mal waren die Gespräche kurz, mal etwas länger. Bisher konnte ich mich jedoch immer davon überzeugen, dass Selbstmord keine Lösung ist.
Ich will mich eigentlich gar nicht umbringen. Und da ist wieder dieses verdammte Wort »eigentlich«. Ich will mich nicht umbringen. Aber ich habe Angst vor dem Tag, an dem ich es vielleicht doch tun werde. Weil die andere Stimme zu laut geworden ist. Weil ich mich selbst nicht mehr sehen kann. Mich nicht mehr ernst nehmen kann. Weil ich ein Versager bin. Weil Menschen ankommen und mir blöde Ratschläge mit auf den Weg geben, weil sie denken, sie würden verstehen, wo mein Problem liegt. Weil sie meinen, etwas ändern zu können.
Ich kenne die Gegenargumente zu meinen eben vorgetragenen Aussagen. Ich habe noch viel mehr Aussagen. Und auch zu denen kenne ich die Gegenargumente. Die rationalen Gegenargumente, die mich manchmal einfach am Arsch lecken können, weil sie mich überhaupt nicht interessieren. Weil sie an mir abprallen, nein, nicht an mir, sondern an dieser verdammten Stimme, die mir immer wieder sagt, wie einfach es doch wäre, all das nicht mehr ertragen zu müssen.
Aber ich höre nicht auf diese Stimme. Weil ich weiß, dass sie Unrecht hat. Trotzdem habe ich Angst. Vor diesem einen, nun schon mehrfach angesprochenen Tag. An dem sie zu laut ist. Und ich zu leise.
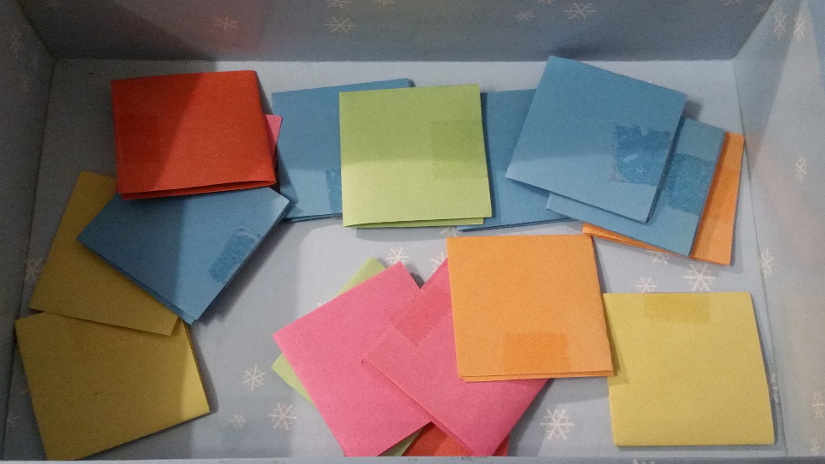

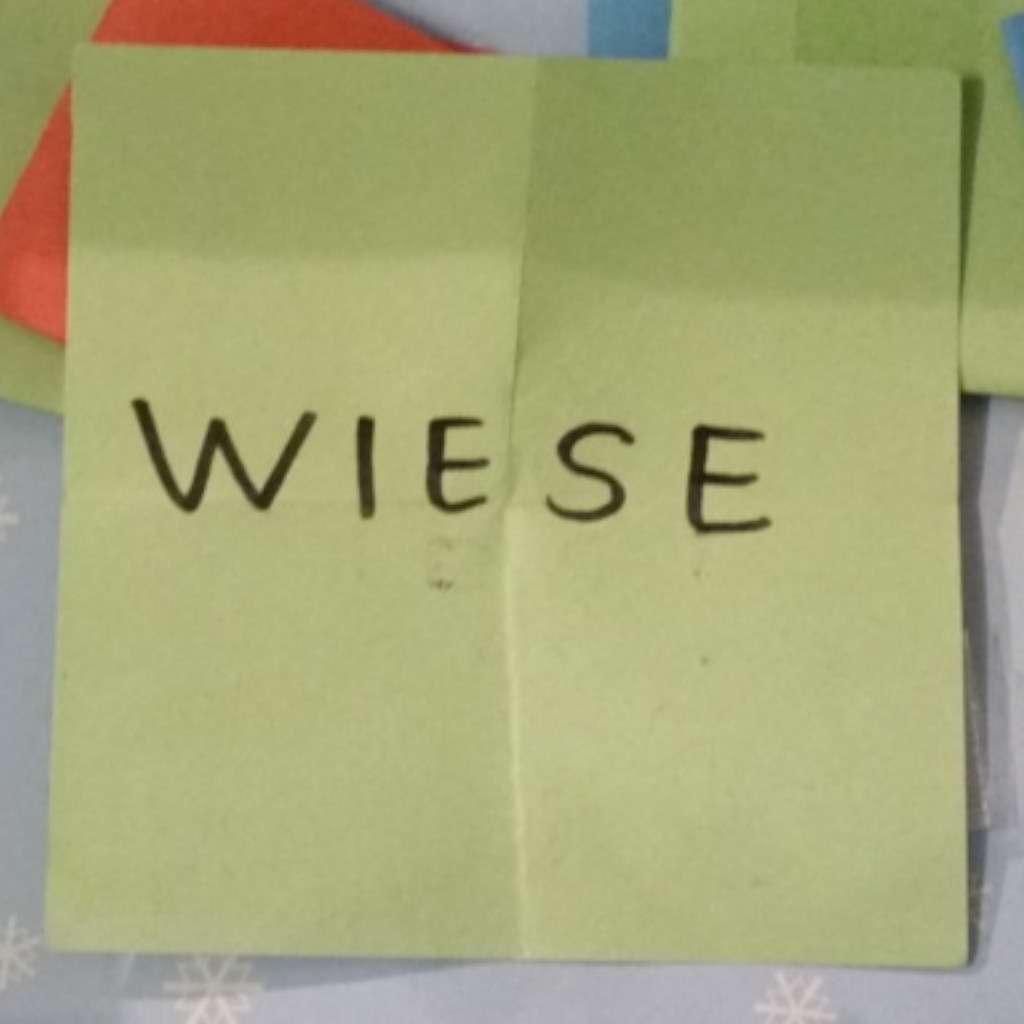
Schreibe einen Kommentar